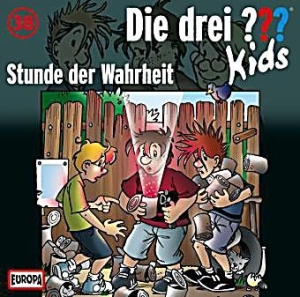Das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs wurde von der Diplomatischen Bevollmächtigtenkonferenz der Vereinten Nationen zur Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs am 17. Juli 1998 in Rom verabschiedet und trat am 1.Juli 2002 in Kraft.
Bisher haben es 114 Staaten ratifiziert, darunter alle EU-Mitgliedstaaten. Die größte Regionalgruppe unter den Vertragsstaaten ist die afrikanische Gruppe.
Aktuelle Informationen zum Ratifikationsstand und zur Arbeit des IStGH finden sich auf den Websites des IStGHs sowie der „Coalition for the International Criminal Court“ (CICC), einem Netzwerk von weltweit über 2500 Nichtregierungsorganisationen zum IStGH.
Die Forderung nach Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs geht auf das vorige Jahrhundert zurück. Bereits 1872 hatte der Schweizer Gustave Moynier unter dem Eindruck der im preußisch-französischen Krieg von 1870/71 begangenen Grausamkeiten den ersten förmlichen Vorschlag zur Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs unterbreitet.
Im Zeitalter der Nationalstaaten und des ausgeprägten Souveränitätsdenkens hatte dieser Vorschlag aber lange Zeit keine Chance. Vor allem wegen der während des Zweiten Weltkriegs begangenen Verbrechen und unter dem Eindruck der Tätigkeit der Internationalen Militärgerichtshöfe von Nürnberg und Tokio wurde diese Idee in den Vereinten Nationen bald nach ihrer Gründung neu belebt.
Die 1948 beschlossene Völkermordkonvention sah in Artikel 6 ein internationales Strafgericht vor, zu dessen Gründung es aber nicht kam. Ebenfalls 1948 beauftragte die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Völkerrechtskommission mit einem solchen Vorhaben. Die Völkerrechtskommission stellte bei ihrer ersten Sitzung 1949 fest, dass die Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs sowohl wünschenswert als auch möglich sei. Weitere Bemühungen im Rahmen der Vereinten Nationen blieben jedoch bald in den Spannungen und Rivalitäten des Kalten Krieges stecken.
Erst 1990, mehr als 40 Jahre nach den ersten Beratungen, erneuerte die Generalversammlung den Auftrag an die Völkerrechtskommission, das Strafgerichtshofsvorhaben zu prüfen. Die massiven Verstöße gegen das Humanitäre Völkerrecht im ehemaligen Jugoslawien und der Völkermord in Ruanda bewogen den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dann, als Zwangsmaßnahmen nach Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen die beiden ad hoc-Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien (Resolution 827/1993) und für Ruanda (Resolution 955/1994) einzurichten. Dies gab dem Vorhaben eines ständigen Internationalen Strafgerichtshofs weiteren Auftrieb.
Am 15. Dezember 1997 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit ihrer Resolution 52/160, die Diplomatische Bevollmächtigtenkonferenz zur Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs vom 15. Juni bis zum 17. Juli 1998 in Rom abzuhalten. Die Konferenz erhielt den Auftrag, den Entwurf für ein Gerichtshof-Statut auszuhandeln und zu verabschieden; ein Auftrag der durch die Verabschiedung des Römischen Statuts am 17. Juli 1998 von Erfolg gekrönt wurde.
Am 11. März 2003 wurden in Den Haag in Anwesenheit der niederländischen Königin Beatrix und des Generalsekretärs der Vereinten Nationen Kofi Annan die Richter vereidigt. Erster Präsident des Gerichtshofes wurde der Kanadier Philippe Kirsch, der 2009 vom Koreaner Sang-hyun Song abgelöst wurde. Zum Chefankläger wählten die Vertragsstaaten im April 2003 den Argentinier Luís Moreno Ocampo.
Inhalte des Römischen Statuts
Inhaltlich bekräftigt und konsolidiert das Statut in vielen Bereichen das geltende Völkerrecht. In einigen Bereichen wurde Neuland betreten.
Die Straftatbestände betreffend Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gemäß Artikel 6 bis 8 des Statuts bilden zusammengenommen eine neuartige Kodifikation, die man als “Besonderen Teil des materiellen Völkerstrafrechts” bezeichnen kann. Diese von der Staatengemeinschaft geschaffene Kodifikation baut auf bereits vorhandenen Völkerrechtsinstrumenten und Quellen auf:
- Artikel 6, Völkermord: entspricht der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords von 1948 (BGBl 1954 II S. 729);
- Artikel 7, Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Grundlage der Verhandlungen war zunächst das Statut des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg; weitere wichtige Orientierungspunkte lieferten die Statute der beiden ad hoc-Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und für Ruanda;
- Artikel 8, Kriegsverbrechen: die insgesamt 50 einzelnen Straftatbestände entstammen weitestgehend bekannten Instrumenten des Humanitären Völkerrechts. Eine besondere Schwierigkeit lag darin, die in den vorhandenen Rechtsquellen zahlreich vorhandenen Verbotsnormen in spezifischen völkerstrafrechtlichen Verbrechenstatbeständen zu erfassen. Quellen für die Einzeltatbestände der Kriegsverbrechen sind:
- die vier Genfer Rot-Kreuz-Übereinkommen von 1949 (BGBl 1954 II S. 781);
- die Zusatzprotokolle I und II zu den Genfer Übereinkommen über den Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte vom 8. Juni 1977 (BGBl 1990 II S. 1550, 1637); das IV. Haager Abkommen von 18. Oktober 1907 betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges, dem die Ordnung betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges (“Haager Landkriegsordnung”) als Anlage beigefügt ist (RGBl1910 S. 5); die Erklärungen vom 29. Juli 1899 betreffend das Verbot der Anwendung von Geschossen mit erstickenden oder giftigen Gasen und das Verbot von Geschossen, die sich leicht im menschlichen Körper ausdehnen oder plattdrücken (RGBl1901 S. 474 ff);
- das Protokoll vom 17. Juni 1925 über das Verbot der Anwendung von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im Krieg (RGBl1925 II S. 405).
In Gestalt der Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach Artikel 7 etabliert das Statut über den vergleichsweise eng begrenzten Völkermordtatbestand nach Artikel 6 hinaus eine gegenüber den Kriegsverbrechen selbständige Tatbestandsgruppe zur Ahndung besonders schwerer Menschenrechtsverletzungen auch in Friedenszeiten. Die Formulierung der Kriegsverbrechen in Artikel 8 bedeutet vor allem insofern eine bedeutsame Konsolidierung einer jüngeren Entwicklung im Humanitären Völkerrecht als in weitem Umfang auch Verletzungen des Humanitären Völkerrechts in nicht-internationalen bewaffneten Konflikten als Kriegsverbrechen erfasst werden.
In Teil 3 wird unter der Überschrift “Allgemeine Grundsätze des Strafrechts” erstmals in einem völkerrechtlichen Vertrag eine Gesamtregelung geschaffen, die man als “Allgemeinen Teil des Völkerstrafrechts” bezeichnen kann. Hierzu gehören fast alle zentralen Fragen der allgemeinen Strafrechtsdogmatik, z. B. Beteiligung mehrerer Personen an einer Tat, Strafbarkeit des Unterlassens und Verjährung. In engem Zusammenhang mit den allgemeinen Grundsätzen des Strafrechts steht die Regelung der Strafen, der Strafzumessung und der Konkurrenz von Verbrechen in Teil 7. Die Todesstrafe ist ausgeschlossen. Eine lebenslange Freiheitsstrafe kann nach 25 Jahren überprüft und ggf. verkürzt werden.
Teil 4 des Statuts enthält in der Sache Gerichtsverfassungsrecht. Dort werden die Organe des IStGH aufgeführt, die Stellung und Wahl der Richter sowie die Einrichtung der Kammern festgelegt und Fragen der Struktur und des Personals von Anklagebehörde und Kanzlei geregelt. Der IStGH setzt sich aus den folgenden Organen zusammen: dem Präsidium, einer Vorverfahrensabteilung, einer Hauptverfahrensabteilung und einer Berufungsabteilung, der Anklagebehörde sowie der Kanzlei.
Die Teile 5, 6 und 8 des Statuts bilden zusammen die Grundzüge einer völkerrechtlichen Strafprozessordnung. Nachdem der Text der Statute der beiden ad hoc-Strafgerichtshöfe noch in sehr starkem Maße angloamerikanisches Strafprozessrechtsdenken widerspiegelt, enthält das Statut eine Synthese unterschiedlicher Rechtsfamilien. Beispielsweise ist der Strafprozess vor dem Gerichtshof nicht als reiner Parteiprozess angelegt, sondern eröffnet die Möglichkeit richterlicher Aufklärung über die von den Parteien vorgebrachten Tatsachen bzw. beigebrachten Beweismittel hinaus. Die Rechte der beschuldigten Person werden in enger Anlehnung an einschlägige Instrumente des internationalen Menschenrechtsschutzes formuliert. Darüber hinaus verfolgen die verfahrensrechtlichen Regelungen an vielen Stellen das Ziel, den Belangen des Zeugen- und Opferschutzes in weitestmöglichem Umfang Rechnung zu tragen. Das erstinstanzliche Verfahren vor dem Gerichtshof umfasst die Stadien des Ermittlungsverfahrens, der Verhandlung über die Bestätigung der Anklagepunkte vor der Vorverfahrenskammer und des Hauptverfahrens mit der Hauptverhandlung vor der Hauptverfahrenskammer. Gegen ein erstinstanzliches Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung zur Rechtsmittelkammer gegeben. Unter engen Voraussetzungen ist auch eine Wiederaufnahme des Verfahrens möglich.
Die praktisch besonders wichtige Zusammenarbeit von Staaten und Gerichtshof wird in Teil 9 geregelt. Das dortige Regime weicht – im Hinblick auf den besonderen Stellenwert der Verfolgung völkerrechtlicher Verbrechen durch den Gerichtshof bei mangelnder Fähigkeit bzw. mangelndem Willen zur Strafverfolgung auf staatlicher Ebene – deutlich von den im zwischenstaatlichen Bereich üblichen Lösungen ab. So werden die Gründe, die Überstellung einer verdächtigen Person an den Gerichtshof abzulehnen, auf das Engste begrenzt; insbesondere sind auch die eigenen Staatsangehörigen des ersuchten Staates von der Überstellungspflicht erfasst. Auch sonstige Rechtshilfemaßnahmen haben die Vertragsstaaten auf Ersuchen des Gerichtshofs grundsätzlich durchzuführen, sofern nicht wesentliche Rechtsgrundsätze der eigenen Rechtsordnung entgegenstehen.
Die Vollstreckung von durch den Gerichtshof verhängten Freiheitsstrafen durch die Vertragsstaaten ist demgegenüber nach den Regelungen in Teil 10 stärker an der konkreten staatlichen Zustimmung ausgerichtet: Nicht nur bedarf es einer gesonderten staatlichen Zustimmung zur Aufnahme in eine beim Gerichtshof geführte Liste vollstreckungsbereiter Staaten, sondern zusätzlich muss der jeweilige Listenstaat der Vollstreckungsübernahme zustimmen, wenn er vom Gerichtshof zur Vollstreckung im Einzelfall bestimmt wird. Hilfsweise obliegt die Vollstreckung von Freiheitsstrafen den Niederlanden als Gaststaat.
In den Teilen 11 bis 13 des Statuts werden Fragen der Versammlung der Vertragsstaaten des Statuts und der Finanzierung des IStGH geregelt sowie die Schlussbestimmungen des Statuts aufgeführt.
Rolle der Bundesrepublik Deutschland
Die Bundesrepublik Deutschland hat an der Ausarbeitung des Statuts aktiv mitgewirkt. Sie hat sich zusammen mit der Gruppe der “gleichgesinnten Staaten”, welche die deutsche Seite mitbegründet hatte, kontinuierlich für einen möglichst effektiven, funktionsfähigen, unabhängigen und damit glaubwürdigen Internationalen Strafgerichtshof eingesetzt.
Nachdem im Herbst 2000 der Deutsche Bundestag und darauf auch der Bundesrat dem Regierungsentwurf zugestimmt hatten und auch die für die Auslieferung Deutscher an den Gerichtshof notwendige Änderung des Art. 16 Grundgesetz beschlossen war, wurde das Gesetz über das Statut am 4. Dezember 2000 verkündet und anschließend im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht. Am 11. Dezember 2000 hinterlegte der Ständige Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen in New York die Ratifikationsurkunde. Damit ist die Bundesrepublik Deutschland an das Statut gebunden. Deutschland ist mit Japan der größte Beitragszahler für den IStGH und engagiert sich darüberhinaus als größter Zahler von freiwilligen Beiträgen in den sog. Opferschutzfonds und in das Zeugenschutzprogramm des Gerichtshofs.
Parallel dazu begannen die Arbeiten an einem deutschen Ausführungsgesetz zum Römischen Statut, das die Einzelheiten der Zusammenarbeit deutscher Gerichte und Behörden mit dem IStGH regelt, und an einem Völkerstrafgesetzbuch (VStGB), das u.a. die im Römischen Statut geregelten Verbrechenstatbestände in das deutsche materielle Strafrecht übernimmt. Beide Gesetze haben im Frühjahr 2002 das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren durchlaufen und sind zum 1. Juli 2002 in Kraft getreten.
Übersetzungen des VStGB in Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Russisch, Portugiesisch und Spanisch befinden sich auf der Website des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg i.Br.. Auf der Website der Universität Göttingen finden Sie daneben auch Übersetzungen des Zusammenarbeitsgesetzes.
Die Bundesregierung wird sich in dem nach wie vor schwierigen politischen Umfeld weiterhin aktiv dafür einsetzen, dass der IStGH möglichst effektiv arbeiten kann und breite Unterstützung in der Staatengemeinschaft findet. Die Bundesregierung ist überzeugt, dass der Gerichtshof im Ringen um mehr Gerechtigkeit und beim Kampf gegen die Straflosigkeit schwerster Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren, einen wirksamen Beitrag leistet und dabei zunehmend universale Bedeutung und Akzeptanz als „Weltstrafgericht“ erlangt.
(Auswärtiges Amt Deutschland)